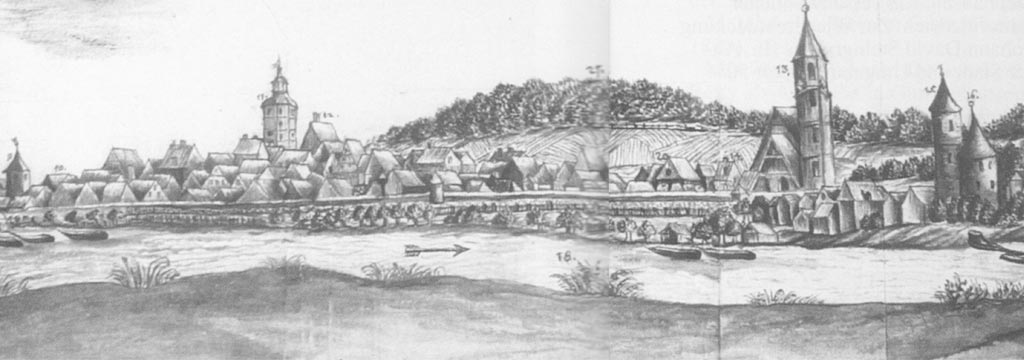Auf der Burg Abenberg
Im Rahmen seiner Reihe „Samstagsexkursionen“ besuchte der Verein für Heimatkunde Gunzenhausen mit seinem Vorsitzenden Werner Falk die Burg Abenberg. Im Haus fränkischer Geschichte begaben sich die Teilnehmer mit der ausgesprochen sachkundigen Führerin Frau Engl auf eine lebendige "Zeitreise durch Franken" vom Mittelalter bis heute: Wie kann man sich das Leben im Mittelalter vorstellen? Wie entwickelte sich Franken in der beginnenden Neuzeit? Wie wirkten sich Reformation, Bauernkrieg und 30-jähriger Krieg auf die Bevölkerung aus?